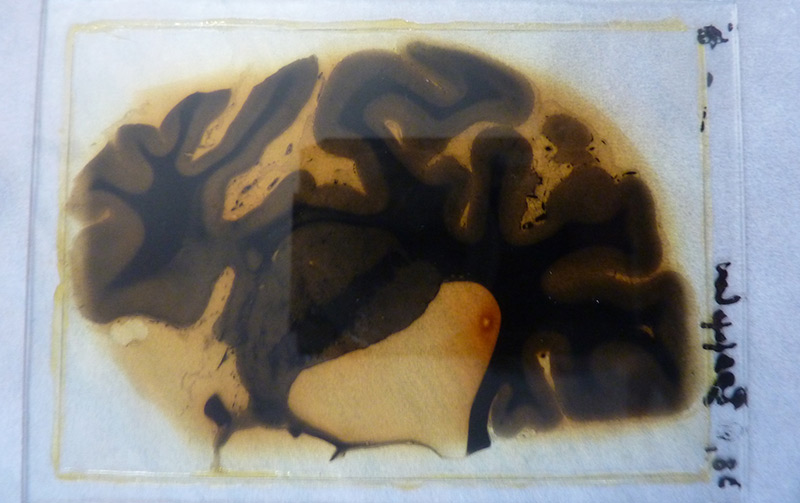"Das "Inventar der Quellen zur Geschichte der 'Euthanasie'-Verbrechen 1939-1945" gibt einen Überblick über die archivalischen Überlieferungen, die sich auf die Vorbereitung und Durchführung des vom NS-Regime organisierten Mordes an psychisch Kranken und anderen Patienten beziehen. Erfaßt wurden einschlägige Quellen in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien.
Die nach ihrer heutigen staatlichen Zugehörigkeit sortierten Standorte der Archive und sonstigen Verwahrstellen bilden das Grundgerüst der Klassifikation des Inventars. Die Arbeiten für den Hauptteil des Projektes, der die Überlieferungen in Deutschland und Österreich umfaßt, sind von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert worden.
Das Projekt wurde von Beginn an -auch in finanzieller Hinsicht- von der Bundesärztekammer mitgetragen.
Frau Brigitte Jensen hat mittels mehrerer Fragebogenaktionen die Grunddaten zu den einzelnen Quellen erhoben, die anschließend von Herrn Dr. Harald Jenner in der vorliegenden Übersicht zusammengestellt worden sind.
Mit finanzieller Unterstützung der Robert Bosch Stiftung hat Herr Jerzy Grzelak den Teil für Polen bearbeitet.
Die Angaben zu den relevanten Überlieferungen in Tschechien, die für die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein erhoben worden sind, stammen von Herrn Dr. Dietmar Schulze.
Unterstützt wurde das Bundesarchiv bei der Durchführung des Gesamtprojektes von einem Wissenschaftlicher Beirat unter der Leitung von Frau PD Dr. Christina Vanja, die neben dem "Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistischen 'Euthanasie' und Zwangssterilisation" zu den Initiatoren des Inventars gehört.
Bei thematischen Fragen, Korrekturen und Ergänzungen wenden Sie sich bitte an Herrn Matthias Meissner, Bundesarchiv, Finckensteinallee 63, 12 205 Berlin, Tel. 01 888 7770-450..."
Quelle und Links: Bundesarchiv
Die nach ihrer heutigen staatlichen Zugehörigkeit sortierten Standorte der Archive und sonstigen Verwahrstellen bilden das Grundgerüst der Klassifikation des Inventars. Die Arbeiten für den Hauptteil des Projektes, der die Überlieferungen in Deutschland und Österreich umfaßt, sind von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert worden.
Das Projekt wurde von Beginn an -auch in finanzieller Hinsicht- von der Bundesärztekammer mitgetragen.
Frau Brigitte Jensen hat mittels mehrerer Fragebogenaktionen die Grunddaten zu den einzelnen Quellen erhoben, die anschließend von Herrn Dr. Harald Jenner in der vorliegenden Übersicht zusammengestellt worden sind.
Mit finanzieller Unterstützung der Robert Bosch Stiftung hat Herr Jerzy Grzelak den Teil für Polen bearbeitet.
Die Angaben zu den relevanten Überlieferungen in Tschechien, die für die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein erhoben worden sind, stammen von Herrn Dr. Dietmar Schulze.
Unterstützt wurde das Bundesarchiv bei der Durchführung des Gesamtprojektes von einem Wissenschaftlicher Beirat unter der Leitung von Frau PD Dr. Christina Vanja, die neben dem "Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistischen 'Euthanasie' und Zwangssterilisation" zu den Initiatoren des Inventars gehört.
Bei thematischen Fragen, Korrekturen und Ergänzungen wenden Sie sich bitte an Herrn Matthias Meissner, Bundesarchiv, Finckensteinallee 63, 12 205 Berlin, Tel. 01 888 7770-450..."
Quelle und Links: Bundesarchiv