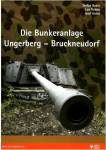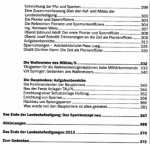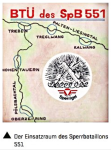Da mit der Veröffentlichung der Dissertation von Mag. Andreas Scherer weiteres umfangreiches Material über die österreichischen Landesbefestigungen ab 1955 und insbesonders über die Ära der "Raumverteidigung" ab Mitte der 1970iger Jahre bis Ende des "Kalten Krieges" zur Verfügung steht, eröffne ich einen Thread für Links, externe Berichte und spezielle Literaturhinweise zu diesen interessanten Themen!
Unsere jahrelangen Sichtungen mit Berichten dazu im Forum über und zu den einst geheimen Anlagen und Einrichtungen, vielfach basierend auf Spekulationen, Gerüchten und sonstigen Vermutungen, bekommen somit einen realen Hintergrund!
Zuerst nochmals der Link zur Dissertation von Oberst dhmfD Mag. Dr. Andreas Scherer:
„Sperren, Bunker und Stellungen: Österreichs Landesbefestigung im Kalten Krieg (Fokus: Zone 73)"
Unsere jahrelangen Sichtungen mit Berichten dazu im Forum über und zu den einst geheimen Anlagen und Einrichtungen, vielfach basierend auf Spekulationen, Gerüchten und sonstigen Vermutungen, bekommen somit einen realen Hintergrund!
Zuerst nochmals der Link zur Dissertation von Oberst dhmfD Mag. Dr. Andreas Scherer:
„Sperren, Bunker und Stellungen: Österreichs Landesbefestigung im Kalten Krieg (Fokus: Zone 73)"