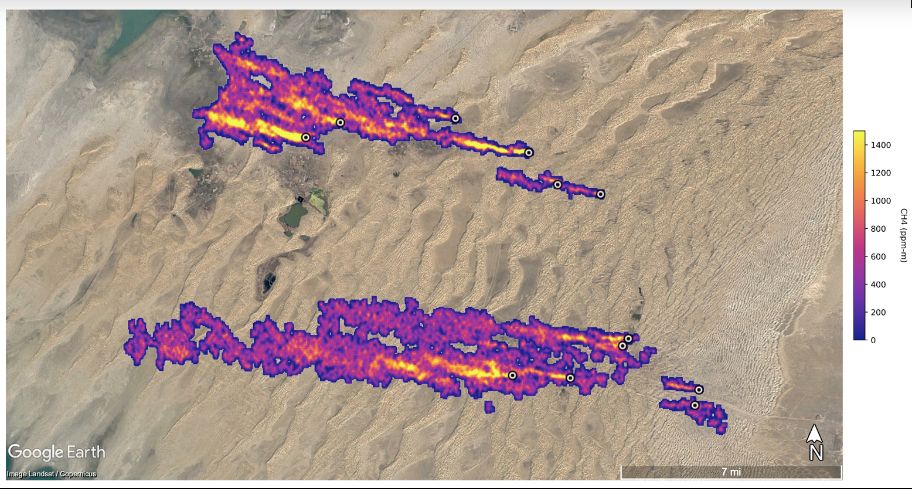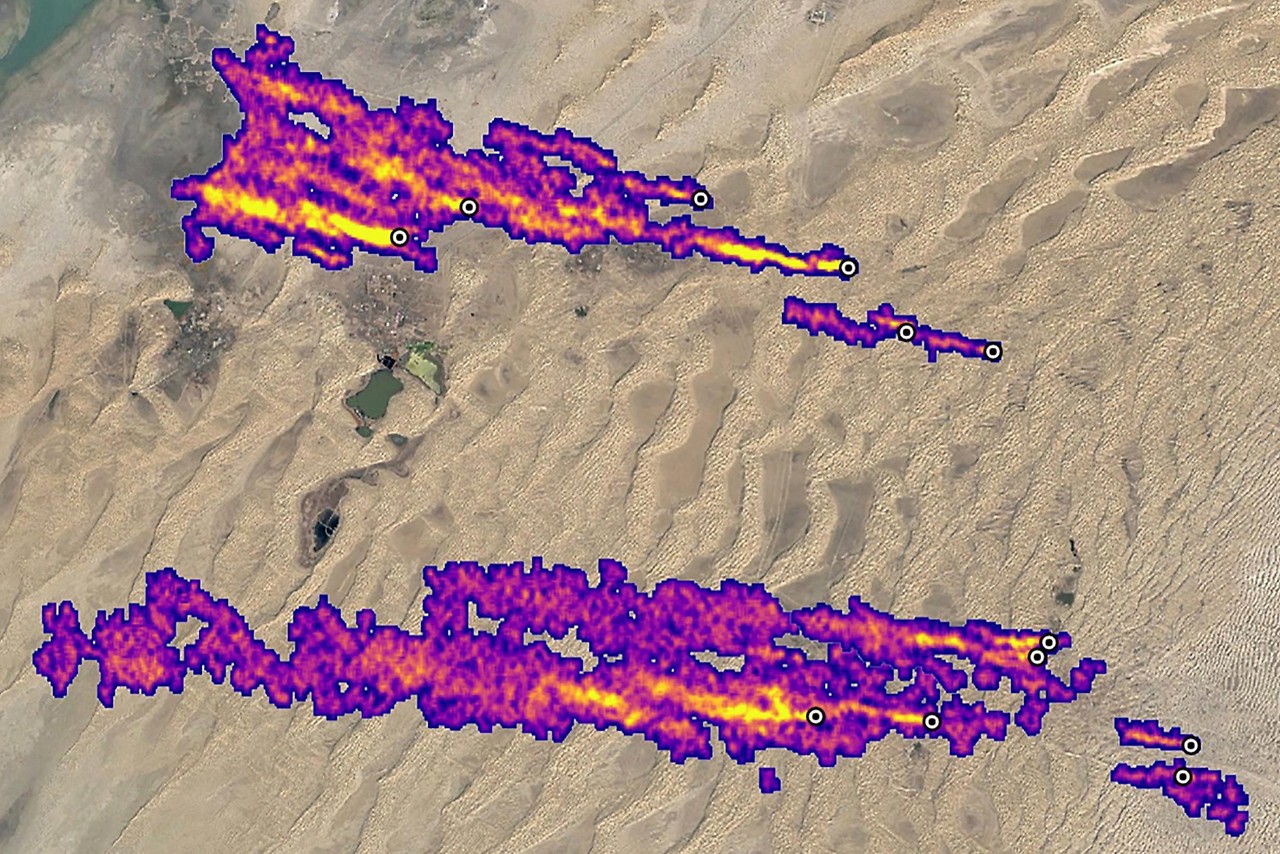EWIGES FEUER
Aus dem "Tor zur Hölle" lodert es seit 50 Jahren
Vor einem halben Jahrhundert entzündeten Geologen in der Karakum-Wüste in Turkmenistan eine irrtümlich angestochene Erdgasblase
 Der Krater von Derweze ist das Ergebnis mehrerer Fehleinschätzungen.Foto: Tormod Sandtorv
Der Krater von Derweze ist das Ergebnis mehrerer Fehleinschätzungen.Foto: Tormod Sandtorv
"Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert." Das berühmte Zitat des irischen Schriftstellers George Bernard Shaw (1856 – 1950) könnte kaum besser passen, als auf jene Leute, die es in den 1970er-Jahren für eine gute Idee hielten, eine riesige Erdgasansammlung unter dem Boden der zentralasiatischen Karakum-Wüste in Brand zu setzen. Das Ergebnis war ein Feuerschlund, aus dem es im "Jubiläumsjahr" 2021 seit nunmehr 50 Jahren lodert.

In der Nacht ist das brennende Loch ein besonders spektakulärer Anblick.
Foto: flydime
Serie von Irrtümern
Die Geschichte einer ganzen Serie von Fehleinschätzungen begann angeblich 1971, als Ingenieure der damaligen Sowjetunion auf der Suche nach ertragreichen Ölvorkommen im Herzen der Karakum in der Teilrepublik Turkmenistan fündig geworden waren – oder zumindest glaubten sie das zunächst.
Schnell waren Bohrtürme errichtet worden, und noch während das Bohrgestänge die ersten paar Meter vorgetrieben wurde, stellte sich auf dramatische Weise heraus, dass man einem Irrtum aufgesessen war: Man war nicht auf Öl sondern auf eine gewaltige Erdgasblase gestoßen. Der Boden unter der Plattform gab nach und ein zwei Dutzend Meter tiefes Loch mit einem Durchmesser von rund 70 Metern tat sich auf – heute bekannt als Krater von Derweze.
Video: Drohnenflug über das "Tor zur Hölle".
Fearless & Far
Der Einsturz setzte eine fatale Kettenreaktion in Gang, bei der es in der ganzen Umgebung zu mehreren ähnlichen Methangasaustritte kam. Die Verantwortlichen wussten um die Gefahr, die von dem Gas ausging, sowohl für die lokale Tier- und Pflanzenwelt, vor allem aber für einige nahe gelegene Siedlungen. Sie taten, was viele tun, wenn sie mit einem bedrohlichen Problem konfrontiert werden: Sie legten Feuer. Die Hoffnung war, dass sich das ausströmende Gas binnen weniger Wochen abfackeln ließe – der nächste Trugschluss, denn der Krater brennt ein halbes Jahrhundert später immer noch.
Rätsel bleiben
Einwandfrei belegt ist diese sowjetische Version vom Ursprung des Kraters von Derweze freilich nicht, denn schriftliche Aufzeichnungen zur Entstehungsgeschichte existieren weder in Moskau noch in Turkmenistans Hauptstadt Aschgabat. Vor Ort wird jedenfalls auch berichtet, dass sich der Krater bereits in den 1960er-Jahren aufgetan haben könnte. Letztlich dürfte seine exakte Herkunft wohl von einigen Mysterien umgeben bleiben.

Der Derweze-Krater aus der Ferne.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen
Feuriger Touristen- und Abenteurermagnet
Wie lange es aus dem "Tor zur Hölle", wie die Einheimischen das Loch im Volksmund nennen, noch weiter lodern wird, können Geologen bis heute nicht einschätzen. Für die Gegend hat sich der Krater von Derweze allerdings mittlerweile auch als Glücksfall erwiesen, denn das Spektakel zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an.
2013 erklärte Gurbanguly Berdimuhamedow, autokratisch regierender Präsident von Turkmenistan, das Gebiet rund um den Krater zum Naturreservat. Im Jahr darauf kletterte der griechisch-kanadische Abenteurer George Kourounis für den National Geographic Channel als erster Mensch zum Grund des Derweze-Kraters hinab und sammelte dort Proben von extremophilen Bakterien.
(tberg, 29.12.2020)
Links
Aus dem "Tor zur Hölle" lodert es seit 50 Jahren - derStandard.at
Aus dem "Tor zur Hölle" lodert es seit 50 Jahren
Vor einem halben Jahrhundert entzündeten Geologen in der Karakum-Wüste in Turkmenistan eine irrtümlich angestochene Erdgasblase

"Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert." Das berühmte Zitat des irischen Schriftstellers George Bernard Shaw (1856 – 1950) könnte kaum besser passen, als auf jene Leute, die es in den 1970er-Jahren für eine gute Idee hielten, eine riesige Erdgasansammlung unter dem Boden der zentralasiatischen Karakum-Wüste in Brand zu setzen. Das Ergebnis war ein Feuerschlund, aus dem es im "Jubiläumsjahr" 2021 seit nunmehr 50 Jahren lodert.

In der Nacht ist das brennende Loch ein besonders spektakulärer Anblick.
Foto: flydime
Serie von Irrtümern
Die Geschichte einer ganzen Serie von Fehleinschätzungen begann angeblich 1971, als Ingenieure der damaligen Sowjetunion auf der Suche nach ertragreichen Ölvorkommen im Herzen der Karakum in der Teilrepublik Turkmenistan fündig geworden waren – oder zumindest glaubten sie das zunächst.
Schnell waren Bohrtürme errichtet worden, und noch während das Bohrgestänge die ersten paar Meter vorgetrieben wurde, stellte sich auf dramatische Weise heraus, dass man einem Irrtum aufgesessen war: Man war nicht auf Öl sondern auf eine gewaltige Erdgasblase gestoßen. Der Boden unter der Plattform gab nach und ein zwei Dutzend Meter tiefes Loch mit einem Durchmesser von rund 70 Metern tat sich auf – heute bekannt als Krater von Derweze.
Video: Drohnenflug über das "Tor zur Hölle".
Der Einsturz setzte eine fatale Kettenreaktion in Gang, bei der es in der ganzen Umgebung zu mehreren ähnlichen Methangasaustritte kam. Die Verantwortlichen wussten um die Gefahr, die von dem Gas ausging, sowohl für die lokale Tier- und Pflanzenwelt, vor allem aber für einige nahe gelegene Siedlungen. Sie taten, was viele tun, wenn sie mit einem bedrohlichen Problem konfrontiert werden: Sie legten Feuer. Die Hoffnung war, dass sich das ausströmende Gas binnen weniger Wochen abfackeln ließe – der nächste Trugschluss, denn der Krater brennt ein halbes Jahrhundert später immer noch.
Rätsel bleiben
Einwandfrei belegt ist diese sowjetische Version vom Ursprung des Kraters von Derweze freilich nicht, denn schriftliche Aufzeichnungen zur Entstehungsgeschichte existieren weder in Moskau noch in Turkmenistans Hauptstadt Aschgabat. Vor Ort wird jedenfalls auch berichtet, dass sich der Krater bereits in den 1960er-Jahren aufgetan haben könnte. Letztlich dürfte seine exakte Herkunft wohl von einigen Mysterien umgeben bleiben.

Der Derweze-Krater aus der Ferne.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen
Feuriger Touristen- und Abenteurermagnet
Wie lange es aus dem "Tor zur Hölle", wie die Einheimischen das Loch im Volksmund nennen, noch weiter lodern wird, können Geologen bis heute nicht einschätzen. Für die Gegend hat sich der Krater von Derweze allerdings mittlerweile auch als Glücksfall erwiesen, denn das Spektakel zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an.
2013 erklärte Gurbanguly Berdimuhamedow, autokratisch regierender Präsident von Turkmenistan, das Gebiet rund um den Krater zum Naturreservat. Im Jahr darauf kletterte der griechisch-kanadische Abenteurer George Kourounis für den National Geographic Channel als erster Mensch zum Grund des Derweze-Kraters hinab und sammelte dort Proben von extremophilen Bakterien.
(tberg, 29.12.2020)
Links